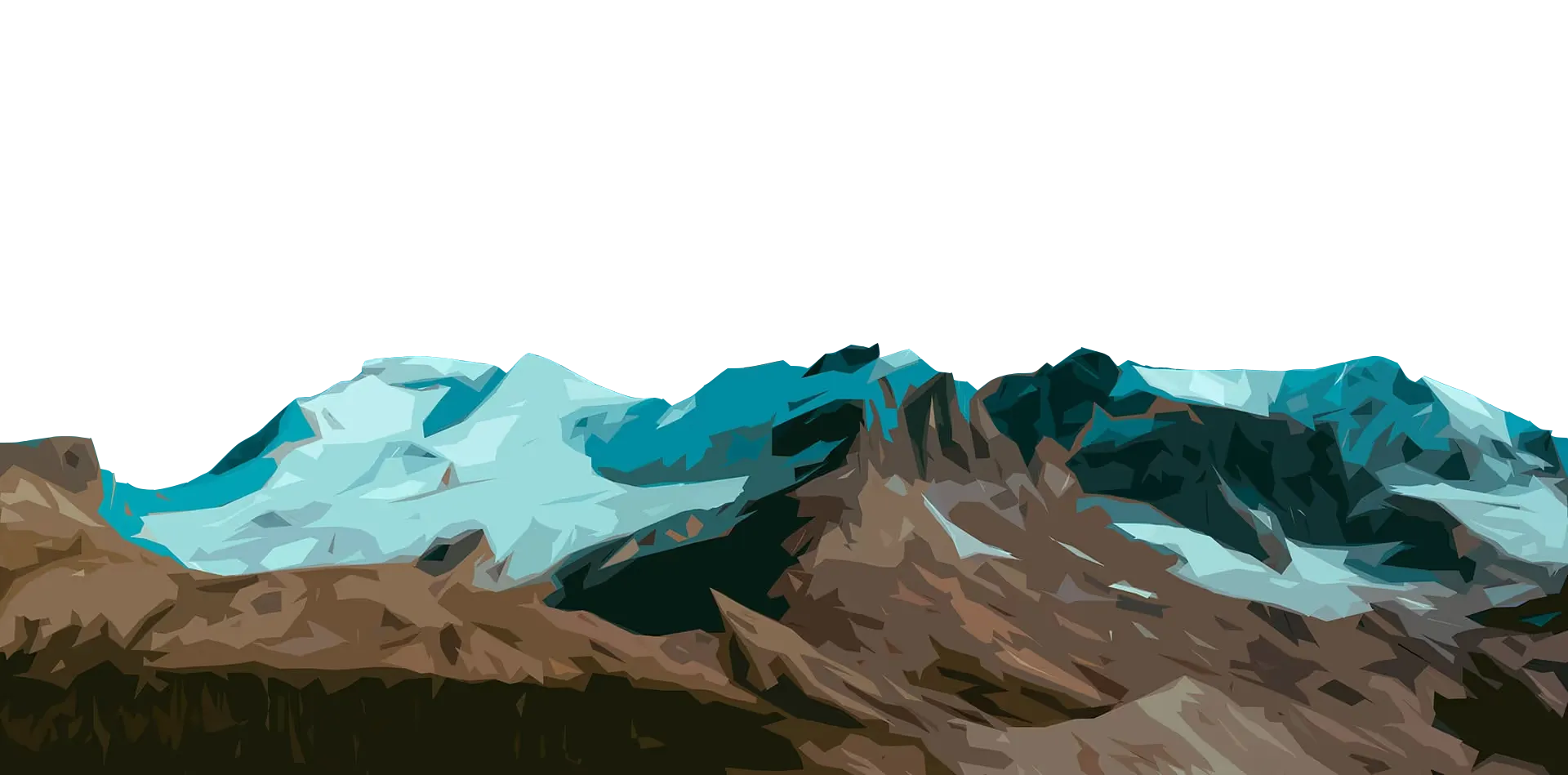Kernaussagen
- Videotherapie ist in Österreich seit 2023 rechtlich anerkannt.
- Datenschutz & DSGVO sind Pflicht – Software muss sicher sein.
- Abrechnung erfolgt meist privat, Kassen beteiligen sich teils.
- Videotherapie ist wirksam, aber Präsenz bleibt wichtig.
- Digitale Tools wie TheraPsy erleichtern Dokumentation & Sicherheit.
Stell dir vor: Du sitzt im Therapiezimmer, bereit für die erste Videositzung mit einer neuen Patientin. Die Verbindung steht, du lächelst – und plötzlich springt ihre Katze mitten ins Bild, legt sich auf die Tastatur und beendet fast das Meeting. Willkommen in der Realität der Videotherapie.

Seit der Pandemie haben über die Hälfte aller Psychotherapeut*innen in Österreich solche Szenen erlebt. Was anfangs improvisiert war, ist heute ein anerkannter Bestandteil psychotherapeutischer Praxis. Doch die Fragen bleiben: Welche Regeln gelten? Wie bleibe ich datenschutzkonform? Und wie schaffe ich eine professionelle Sitzung – selbst wenn Haustiere oder WLAN-Störungen mitspielen?
Was versteht man eigentlich unter Videotherapie?
Videotherapie (oder Online-Therapie) bedeutet, psychotherapeutische Gespräche über eine sichere Videoverbindung zu führen. Sie unterscheidet sich von Telefonaten oder Chat-Angeboten dadurch, dass Therapeutin und Patientin einander sehen – also Mimik, Gestik und Atmosphäre möglichst nah an einer Präsenzsitzung vermittelt werden.
Die österreichische Berufsordnung betont, dass psychotherapeutische Arbeit „persönlich und unmittelbar“ erfolgen soll. Videotherapie gilt als Ergänzung, nicht als Ersatz der Präsenz. Das heißt: Sie kann therapeutische Prozesse sinnvoll stützen, ersetzt aber nicht in allen Fällen das persönliche Gegenübersitzen.
Welche rechtlichen Vorgaben gelten in Österreich?
Situation in Österreich
- Seit 2023 ist Videotherapie rechtlich anerkannt.
- Die Richtlinien des Gesundheitsministeriums (2025) erlauben Videotherapie, solange berufliche Pflichten eingehalten werden.
- Innerhalb der ersten fünf Sitzungen sollte mindestens eine in Präsenz stattfinden.
- Therapeutinnen müssen Patientinnen über Chancen und Grenzen aufklären.
- Dokumentation ist Pflicht – Sitzungen sollten klar als „Videotherapie“ gekennzeichnet werden.
Unterschiede zu Deutschland
In Deutschland war Videotherapie lange strenger geregelt. Bis 2024 durfte nur ein Teil der Leistungen per Video erfolgen. Seit 2025 gelten flexiblere Regeln: Bis zu 50 % der Behandlungsfälle können rein per Video stattfinden. Dafür müssen Therapeut*innen einen zertifizierten Videodienst nutzen und die KV informieren.
In Österreich hingegen liegt die Verantwortung stärker bei den Therapeutinnen selbst: Auswahl eines DSGVO-konformen Tools, Aufklärung der Patientinnen und sorgfältige Dokumentation.
Wie sicher ist Videotherapie wirklich? (Datenschutz & Technik)
Viele Therapeut*innen fragen sich: „Kann ich Zoom verwenden?“ Die Antwort ist meist: „lieber nicht“.
Für Österreich gilt:
- Videodienste müssen Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein.
- Daten dürfen nur innerhalb des DSGVO-Raums gespeichert werden.
- Keine Aufzeichnung der Sitzung erlaubt.
- Es sollte ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AV-Vertrag) mit dem Anbieter bestehen.
Empfohlene Tools sind speziell für Therapie entwickelt – sie bieten sichere Server und keine unnötigen Funktionen.
Wie funktioniert die Abrechnung von Videotherapie in Österreich?
Die Realität in Österreich ist etwas komplexer als in Deutschland:
- Die meisten Psychotherapeut*innen arbeiten privat.
- Krankenkassen erstatten meist Teilbeträge, auch für Videotherapie (analog zu Präsenz).
- Zusatzversicherungen übernehmen zunehmend digitale Leistungen, solange die Therapeut*innen approbiert sind.
- Wichtig: Auf Honorarnoten sollte klar erkennbar sein, ob es sich um eine Videotherapie handelt.
Welche Chancen und Grenzen hat Videotherapie?
- Chancen:*
- Niedrigere Hürden für Patient*innen (keine Anfahrt, mehr Flexibilität).
- Besonders hilfreich für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder in ländlichen Regionen.
- Studien zeigen: Videotherapie ist ähnlich wirksam wie Präsenz, solange Setting und Indikation passen.
- Grenzen:*
- Technische Probleme können Sitzung stören.
- Nonverbale Signale sind eingeschränkt.
- Manche Themen brauchen die Sicherheit des realen Raums.
- Einige Therapiemethoden oder Interventionen lassen sich nur real durchführen.
Welche Kompetenzen brauchen Therapeut*innen für digitale Settings?
Das Psychotherapiegesetz (§40 PThG 2024) schreibt vor, dass Therapeut*innen für Online-Formate geschult sein müssen. Dazu gehört:
- Kenntnis über rechtliche Grundlagen.
- Digitale Methodenkompetenz (z. B. Umgang mit Technik, Online-Settings gestalten).
- Aufklärungspflicht über Grenzen: Patient*innen müssen wissen, dass bei Krisen (z. B. akute Suizidalität) Videotherapie nicht ausreicht.
Wie gelingt eine gelungene Videositzung? (Praktische Tipps & Checkliste)
Eine Videotherapie ist mehr als ein „Skype-Gespräch“. Sie braucht Struktur, Klarheit und gute Vorbereitung.
Videotherapie lebt nicht nur von guter Technik, sondern auch von klarer Vorbereitung und einer sicheren therapeutischen Haltung. Damit du entspannt in deine nächste Sitzung starten kannst, haben wir die wichtigsten Punkte für dich in Worte gefasst:
- VorbereitungBevor du die Kamera einschaltest, kläre deine Patient*innen über Ablauf, Chancen und auch die Grenzen der Videotherapie auf. Hole ihre Einwilligung ein – am besten schriftlich, damit beide Seiten Sicherheit haben. Vergiss nicht, in deiner Dokumentation zu vermerken, dass es sich um eine Videotherapie handelt.
Zur Vorbereitung gehört auch, kleine Stolperfallen von vornherein auszuschließen: Vereinbare klare Regeln mit deinen Patient*innen – etwa, was zu tun ist, wenn die Verbindung abbricht. Trainiere bewusst den Blickkontakt, indem du nicht auf dein eigenes Bild schaust, sondern direkt in die Kamera. Und achte darauf, dass das Setting ruhig und neutral wirkt: ein geordneter Raum, keine ablenkenden Hintergründe, eine Atmosphäre, die Vertrauen schafft.
- Technisches SetupEine stabile Basis ist Gold wert. Nutze eine DSGVO-konforme Software wie TheraPsy, prüfe Kamera, Ton und Internetverbindung rechtzeitig und sorge dafür, dass keine Aufzeichnungen möglich sind. So startest du stressfrei in die Sitzung.
- Datenschutz & RahmenbedingungenAuch online gilt die Schweigepflicht uneingeschränkt. Achte darauf, dass niemand mithören oder mitsehen kann. Schließe mit deinem Videodienst einen AV-Vertrag ab und sorge für eine vertrauliche Umgebung. Das gibt nicht nur dir, sondern auch deinen Patient*innen ein Gefühl von Sicherheit.
- SitzungsdurchführungWähle einen professionellen Hintergrund und eine gute Beleuchtung – du bist schließlich das „Setting“. Versuche, in die Kamera zu schauen, um Augenkontakt zu simulieren, und sprich mit deinen Patient*innen ab, wie ihr bei technischen Problemen vorgeht. Kleine klare Regeln schaffen große Gelassenheit.
- NachbereitungDokumentiere die Sitzung genauso wie eine Präsenzsitzung. Nimm dir Zeit für ein ehrliches Feedback: „Wie war die Sitzung für dich?“ – diese Rückmeldung kann sehr wertvoll sein. Reflektiere auch selbst, ob Videotherapie für diese Person langfristig geeignet ist.
Welche Software eignet sich für Videotherapie?
Nicht jedes Tool ist erlaubt. WhatsApp, Skype oder Zoom sind in der Regel ungeeignet – zu unsicher, nicht DSGVO-konform.
Geeignet sind Tools, die speziell für psychotherapeutische Arbeit entwickelt wurden:
- DSGVO-konform
- Server in der EU
- AV-Vertrag verfügbar
- Keine Speicherung oder Aufzeichnung
👉 TheraPsy erfüllt diese Vorgaben – und geht noch weiter: Es integriert Videotherapie, Dokumentation und Praxisorganisation in einer Lösung.
ℹ️ Infobox: Was ist ein AV-Vertrag?
Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AV-Vertrag) ist in der DSGVO vorgeschrieben, sobald personenbezogene Daten über einen externen Dienstleister verarbeitet werden. Bei der Videotherapie betrifft das den Anbieter der Videoplattform: Er überträgt Bild- und Tondaten im Auftrag der Therapeut*innen.
Der Vertrag regelt:
- Welche Daten verarbeitet werden
- Welche Sicherheitsmaßnahmen bestehen
- Welche Rechte und Pflichten du als Therapeut*in hast
Ohne AV-Vertrag riskierst du einen DSGVO-Verstoß – und damit mögliche Strafen.
👉 Gut zu wissen: TheraPsy stellt dir einen AV-Vertrag direkt zur Verfügung. Damit bist du rechtlich auf der sicheren Seite und kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren: deine Patient*innen.
Erfahrungen aus der Praxis: Was berichten Kolleg*innen?
Viele Therapeutinnen berichten, dass sie anfangs skeptisch waren – doch Patientinnen nehmen Videotherapie erstaunlich gut an. Besonders jüngere Generationen schätzen die Flexibilität.
Sabine*, Psychotherapeutin aus Wien, war anfangs überzeugt, dass sich eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung nur im Praxisraum aufbauen lässt. Während der Pandemie entschied sie sich notgedrungen für Videotherapie. Eine junge Patientin mit Prüfungsangst nahm die digitale Variante sofort an – nicht zuletzt, weil sie sich in den eigenen vier Wänden sicherer fühlte.
Nach einigen Sitzungen bemerkte Sabine, dass die Patientin vor dem Bildschirm leichter über belastende Themen sprach als im Praxisraum. Die vertraute Umgebung zu Hause half ihr, Hemmschwellen abzubauen. Heute bietet sie Videotherapie als festen Bestandteil ihrer Praxis an – nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Ergänzung.
- Name geändert
Studien (z. B. PMC, 2023) zeigen, dass therapeutische Allianz und Wirksamkeit online vergleichbar sind – solange Setting und Beziehungsgestaltung stimmen.
Videotherapie ist kein Notnagel der Pandemie, sondern ein fester Bestandteil moderner psychotherapeutischer Arbeit in Österreich. Sie bringt neue Chancen – mehr Flexibilität, mehr Reichweite – aber auch klare Pflichten: Datenschutz, Einwilligung, Dokumentation.
👉 Teste TheraPsy Connect, die Videotherapie-Plattform von TheraPsy. Erhalte bei Registrierung 15 Gratis Anrufe zum Testen. https://therapsy.at
FAQ
.webp)
Über 6000 TherapeutInnen sind bereits überzeugt!
Teste TheraPsy einen Monat kostenlos und entdecke, wie einfach Dokumentation sein kann!
Quellen
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. (2025). Richtlinien zur Videotherapie. sozialministerium.gv.at
Österreichischer Berufsverband für Psychotherapie (ÖBVP). (2024). Empfehlungen zur Videotherapie. psychotherapie.at
Hagleitner, P. (2023). Online- und Videotherapie in Österreich – rechtliche Grundlagen. psychotherapiepraxis-hagleitner.at
Bundespsychotherapeutenkammer. (2024). Videobehandlung in Deutschland: Leitlinien und Abrechnung. api.bptk.de
PMC. (2023). Effectiveness of video-based psychotherapy: Meta-analysis. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
Anmerkung
Dieser Artikel dient nur zur Information und ersetzt keine medizinische oder rechtliche Beratung. Konsultiere bei Bedarf eine Fachperson.